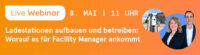Glossar:
A
Die Abkürzung AC steht für „Alternating Current“, das bedeutet übersetzt Wechselstrom. AC – Ladungen finden vorwiegend mit einer Ladeleistung von bis zu 22kW (Kilowatt) statt. Bevorzugt wird diese Ladetechnologie für Ladevorgänge mit längeren Standzeiten verwendet, bspw. zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Ist das Ladekabel an der Ladesäule bereits angebracht, spricht man von einem angeschlagenem Ladekabel. Dies hat den Vorteil, dass der Nutzer kein eigenes Ladekabel für den Ladevorgang mitbringen muss.
B
Die Kapazität gibt die Energiemenge an, die eine Batterie liefern bzw. speichern kann. Die Batteriekapazität ist von dem Volumen sowie dem Zellentyp abhängig. Sie wird in der Einheit kWh angegeben.
C
Der Charge Point Operator (CPO) ist für den technischen Betrieb der Ladeinfrastruktur zuständig. Neben der Wartung und dem Service eines Ladepunktes, ist er auch für die Stromversorgung der Ladestationen verantwortlich. Er kann, muss aber nicht, der Besitzer der Ladestationen sein.
D
Die Abkürzung DC steht für „Direct Current“, das bedeutet übersetzt Gleichstrom. DC-Ladungen finden überwiegend mit einer Ladeleistung von größer 50kW statt. Bevorzugt wird diese Ladetechnologie für Ladevorgänge mit kurzen Standzeiten verwendet, bspw. an Rastplätzen oder Supermärkten.
E
Der E-Mobility Provider (EMP) ermöglicht den Ladevorgang. Er stellt bspw. die RFID-Ladekarten zur Verfügung. Mit dieser Ladekarte kann der Nutzer den Ladevorgang starten, während der EMP den Ladevorgang im Hintergrund frei gibt. Zudem ist er der Ansprechpartner für den Nutzer in Bezug auf die Tarifstrukturen oder Ladevorgänge.
Das Echtzeitmonitoring beschreibt die systemseitige Überwachung sowie die systematische Erfassung und Protokollierung von Ladevorgängen in Echtzeit.
Synonym für Ladesäule
F
Die Elektromobilität gilt als wichtiger Treiber in Deutschland und E-Autos sind mehr denn je gefragt, dass zeigen die Neuzulassungen aus dem Jahr 2020. Aus diesem Grund gibt es seitens der Länder und dem Bund einige interessante Förderungen zur Anschaffung von E-Autos sowie für den Aus- und Aufbau von Ladeinfrastruktur.
G
Ökostrom, Naturstrom oder Grünstrom stehen für elektrische Energie aus erneuerbaren und umweltschonenden Energieanlagen wie beispielsweise der Wasserkraft, von Windkrafträdern oder aus Photovoltaik-Anlagen.
H
Die Haushaltssteckdose wird auch Schuko-Stecker genannt. Eine haushaltsübliche Steckdose mit 230 Volt kann maximal eine Ladeleistung von 2,3 kW pro Ladepunkt erzeugen. Beispielsweise bräuchte ein BMW i3 rund 13 Stunden, um 80% geladen zu sein.
Wird das Elektrofahrzeug zuhause geladen, spricht man von einer Heimladung. Diese erfolgt in der Regel mit Wechselstrom (AC). Aufgrund dessen wird die Heimladung häufig als AC-Ladung bezeichnet.
I
Geparkt wird das Fahrzeug über einer Magnetspule, welche über ein Gegenstück im Fahrzeugboden berührungslos auflädt. Durch elektromagnetische Wellen wird die Energie an der Akku abgegeben und das E-Auto voll geladen.
J
Die Jahresbenutzungsdauer beschreibt die Anzahl der Stunden, in denen Sie durchgängig Strom mit der Maximalleistung bezogen hätten.
Als Jahreshöchstleistung wird die maximale Leistung bezeichnet, die aus dem Stromnetz über einen Netzanschlusspunkt innerhalb eines Jahres entnommen wird.
K
Die Kilowattstunde ist nicht nur eine Maßeinheit für den Strompreis. Elektroautos besitzen eine Batteriekapazität von rund 10 bis über 100kWh. Jedoch ist die reale Reichweite von Elektroautos nicht direkt von der Akkukapazität ableitbar. Viele andere Faktoren beeinflussen diese, beispielsweise Umwelteinflüsse, z.B. kalte Außentemperaturen oder das eigene Fahrverhalten.
L
Eine Ladeinfrastruktur beschreibt mehrerer Ladepunkte in bspw. einem Parkhaus, einem Bundesland oder ganz Deutschland.
Beispiel: Mit finanzieller Unterstützung versucht die Bundesregierung den Aufbau mehrerer Ladepunkte für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland voranzutreiben.
Unter der Ladeleistung versteht man die maximale Leistungsaufnahme des E-Fahrzeugs während eines Ladevorgangs. Je höher diese ist, desto schneller ist der Ladezustand wieder bei 100 Prozent.
Vorsicht: Nicht jedes E-Fahrzeug kann mit der maximalen Ladeleistung der Ladestation geladen werden! Beispielsweise kann ein BMW i3 nur mit 11 kW AC laden. Wenn er an einer Wallbox mit 22 kW angesteckt wird, lädt er trotzdem nur mit 11 kW.
Um den Ladevorgang mehrerer Elektrofahrzeuge zu koordinieren, wird in eine Ladestation das Lademanagement integriert. Das Lademanagement bestimmt wie mehrere E-Autos geladen werden können. Die verschiedenen E-Autos können z.B. gleichzeitig, sequentiell oder priorisiert geladen werden.
Weitere Informationen zum Lademanagement finden Sie in unserem Ratgeber.
Ein Elektrofahrzeug wird an einem Ladepunkt geladen. Können an einer Ladesäule zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, verfügt die Ladestation über zwei Ladepunkte.
Die Ladesäulenverordnung, ist eine gesetzliche Verordnung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. In dieser Verordnung sind die Mindestanforderungen an öffentlichen Ladepunkt definiert.
Die Ladezeit hängt von mehreren Faktoren ab:
- Die Ladeleistung der Ladestation oder Steckdose
- Die Kapazität der Batterie
- Der Ladestand der Batterie (state of charge)
- Die Ladetechnik des E-Autos
Der Ladezustand, auch State of Charge genannt, beschreibt das Verhältnis der aktuellen Lademenge zur gesamten Lademengenenkapazität in Prozent.
Beim Lastmanagement wird zwischen einem statischen und dynamischen differenziert.
Beim statischen Lastmanagement wird die maximale Leistung für die Ladeinfrastruktur festgelegt. Diese Leistung kann nicht überschritten werden, auch wenn mehr Leistung zur Verfügung stehen würde.
Das dynamische Lastmanagement passt sich kontinuierlich dem Angebot des verfügbaren Stroms an. Dadurch kann der Netzanschluss optimal genutzt werden. Eine ausführliche Erklärung des Lastmanagements finden Sie in unserem Ratgeber.
Wird kurzfristig viel Leistung aus dem Stromnetz aufgrund einer hohen Nachfrage benötigt, kann es zu einer Lastspitze kommen. Dadurch kann es zu einer Überbeanspruchung und auch zur Überlastung des Netzanschlusses kommen.
M
Dieses sogenannte „Notfallladekabel“ zeichnet sich dadurch aus, dass es neben dem passenden Anschluss (Typ 1- oder Typ 2-Stecker) für das Auto, einen Schuko-Stecker auf der anderen Seite hat. Die Kommunikation zwischen dem E-Auto und der Haushaltssteckdose übernimmt dabei eine In-Cabel-Controlbox (kurz: ICCB). Diese Steuerbox, die sich zwischen Fahrzeugstecker und Anschlussstecker befindet, wird dafür benötigt, die Stromstärke bei Steckdosen zu begrenzen. Allerdings kann diese kein Lastmanagement – wie es bei Ladestationen der Fall ist – durchführen, um zum Beispiel Lastspitzen zu verhindern.
Das Mode 3-Ladekabel ist ein Verbindungskabel zwischen Ladestation und E-Auto. Sie unterscheiden sich lediglich nach dem Stecker auf der Fahrzeugseite: In Europa hat sich der Typ 2-Stecker durchgesetzt – einige ältere Modelle haben aber auch einen Typ 1-Stecker.
N
Die Netzanschlusskapazität definiert die maximale Leistung, die dem Kunden als Energie zur Verfügung gestellt werden kann.
Nutzt eine Person/Haushalt Strom oder Gas, muss eine Gebühr an den Netzbetreiber bezahlt werden, dem das Netz gehört. Das Netzentgelt ist ein fester Bestandteil des Strom- und Gaspreises. Häufig ist der Begriff Netzentgelt, auch als Netznutzungsentgelt bekannt.
Eine Auflistung der einzelnen Bestandteile des Netzentgeltes hat die Bundesnetzagentur zusammengestellt.
Hierzu zählt jeder, der das Netz nutzt. Also, Strom aus dem Netz bezieht oder Strom in das Netz durch bspw. eine PV-Anlage einspeist.
In dem Bereich der Elektromobilität wird von einer Notladung gesprochen, wenn das E-Auto an einer Haushaltssteckdose geladen werden muss, da keine Ladestation zur Verfügung steht.
O
Elektroautos lassen sich allein mit dem Gaspedal beschleunigen und bremsen – auch One-Pedal-Driving oder „Fahren mit einem Pedal“ genannt. Wie funktioniert das? Drückt der Fahrer das Gas-/E-Pedal beschleunigt das Auto, nimmt der Fahrer den Fuß herunter, bremst das Auto automatisch. Wichtig zu wissen: Ein separates Bremspedal ist dennoch vorhanden.
P
Das Hybridauto kombiniert einen konventionellen Motor und einen Elektromotor. Hybridfahrzeuge bewegen sich einige Kilometer elektrisch fort. Sobald die Batteriekapazität erschöpft ist, greift der konventionelle Antrieb. Die Besonderheit an einem Plug-In-Hybrid ist, dass dieser per Ladekabel Energie laden kann, im Gegensatz zu einem Hybridfahrzeug, welches nicht extern geladen werden kann.
Q
Der Quelltext oder auch Quellcode ist ein Text, der in Programmiersprache geschrieben wird – auch Softwaredokument genannt. Typische Programmiersprachen sind beispielsweise Java, Python, C, Shell und HTML.
R
Rekuperation bedeutet Rückgewinnung. Beim Bremsen eines Elektroautos wird der Elektromotor zum Generator und es wird Energie erzeugt. Diese Energie geht nicht als Wärmeenergie verloren, sondern wird zurückgewonnen und fließt als Ladeenergie in die Batterie zurück. Rund 20% Energie lässt sich mit der Rückgewinnung einsparen.
Die Ladekarten, die für den Ladevorgang eines Elektrofahrzeuges notwendig sind, enthalten einen RFID-Chip. Dieser Chip ermöglicht eine eindeutige Zuweisung des Kartenbesitzers, wodurch die Authentifizierung an dem Ladepunkt ermöglicht wird. Erst wenn die Ladestation anhand der Ladekarte den Nutzer erkennt, ist es möglich, den Ladevorgang zu starten.
S
Eine Schnellladestation lädt das Fahrzeug mit Gleichstrom (DC) mit bis zu 300 kW. Im Vergleich zu einer normalen Ladestation kann der Ladevorgang aufgrund der höheren Ladeleistung deutlich schneller abgeschlossen werden. Die genaue Ladedauer ist von dem Fahrzeugmodell abhängig.
Schuko ist die Abkürzung für Schutzkontakt. Bei einem Schuko-Stecker handelt es sich um einen handelsüblichen Haushaltsstecker in Deutschland.
Ein Spiralladekabel, ist ein sprialförmiges Ladekabel. Dieses bietet den Vorteil, dass das Ladekabel nur wenig Platz für seine große Länge benötigt und sehr dehnbar ist.
T
Wenn Akkus unter anhaltender Last stehen, wird Wärme erzeugt. Das beeinflusst die Leistungsabgabe der Energiespeicher und gleichzeitig die Fähigkeit Strom zu speichern. Elektroautos besitzen deshalb ein ausgeklügeltes Thermomanagement.
U
Ultraschnellladesäulen werden auch High Power Charger (HPC) genannt. Durch das Ultraschnellladen können bereits einige Elektroautos mit bis zu 300 kW innerhalb von 5 Minuten rund 100km Reichweite laden. Wichtig zu wissen: Noch nicht jedes E-Auto kann heutzutage ultraschnellladen.
V
Vampirverlust beschreibt das Phänomen, dass sich Elektroautos im Ruhezustand selbst entladen können. Häufig ist dieses Phänomen kaum bemerkbar, das es nur selten zu sehr starken Entladungen kommt. Daher trifft der Begriff nur auf wenige Einzelfälle zu.
W
Als eine Wallbox wird eine Ladestation bezeichnet, die an der Wand oder auf einer Säule fest installiert ist. Der Name der Wandladestation ist abhängig des Herstellers. Es gibt Leistungsstufen zwischen 3,7 und 22kW – 11kW wird jedoch am häufigsten aufgebaut.
X
V2X bzw. Car2x bedeutet Vehicle- bzw. Car-to-Everything. Das ist eine Technik, durch die Fahrzeuge mit ihrer Umwelt kommunizieren können. Der Austausch von Informationen findet sowohl vom Auto zur Umwelt als auch andersherum statt. Die Motivation hinter diesem Ansatz ist die Sicherheit auf den Straßen und die Effizienz des Verkehrs zu erhöhen und Energie einzusparen.
Y
Z
Der (Strom-)Zähler ist misst z.B. den Energieverbrauch eines Haushaltes. Aber auch in der Elektromobilität spielt der Zähler eine Rolle. Dadurch kann nach jedem Ladevorgang die exakt geladene Strommenge nachgewiesen und auch angezeigt werden. Der Stromzähler ist ein eichpflichtiges Messgerät.